Mit den Vertriebenen begann die Ökumene
Alexander WernerSeit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat die konfessionelle Prägung der Gemeinden abgenommen
Linkenheim-Hochstettten. In den Kommunen nördlich von Karlsruhe gehört Ökumene längst zum Leben der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden. Ergeben hat sich das auch dadurch, dass sich die Orte ab 1945 konfessionell komplett veränderten.
Ein Auslöser dafür war der starke Zuzug von katholischen Heimatvertriebenen in die seit 1556, dem Jahr der Reformation in Baden, evangelisch geprägten Gemeinden. Dazu kamen hohe Einwohnerzuwächse wie in der Hardt über das Kernforschungszentrum. Zudem siedelten sich über Neubaugebiete auch in traditionell katholischen Orten Evangelische an.
„Das Hardtgebiet ist klassisch evangelisch geprägt, während nördlich die Einflüsse auf das frühere katholische Bistum Speyer zurückgehen“, resümiert Hans-Martin Steffe. Der Linkenheimer war früher lange Zeit Pfarrer in Südbaden und leitete 14 Jahre das Amt für Missionarische Dienste im Evangelischen Oberkirchenrat.
„Politisch war es in der Regierung unter Konrad Adenauer nach dem Krieg gewollt, dass sich die Orte konfessionell vermischen. Es sollte das Miteinander fördern“, erklärt Steffe. Man habe versucht, dies über den Zuzug von Heimatvertriebenen zu steuern. Bei Linkenheim spricht der 72-Jährige trotz vieler zugezogener Katholiken von einem noch deutlich höheren Anteil von Evangelischen. Zudem besitzt Linkenheim mit Wurzeln im Pietismus noch eine evangelische Freikirche (FeG) und die evangelische Gemeinschaft der Liebenzeller.
In Eggenstein steht eine ältesten Kirchen der Region auch für den Epochenwandel. Die erste urkundliche Erwähnung datiert auf 1160. Umgebaut wurde sie 1475 als noch katholisches und 1781 als längst evangelisches Gotteshaus. In Eggenstein sind es heute 3.201 Evangelische, in Leopoldshafen rund 2.200. In der katholischen Kirchengemeinde Hardt sind es in Eggenstein 2.185 und in Leopoldshafen 1.690. In Pfinztal liegt der evangelische Anteil rund 15 Prozent höher als der katholische. Berghausen hat derzeit 2.512 evangelische und 1.545 katholische Gemeindemitglieder.
Im Zuge der Napoleonischen Kriege und der Säkularisation fielen die katholischen Dörfer Wöschbach, Neudorf und Jöhlingen 1803 mit dem Reichsdebutationshauptschluss von Speyer an das zum Großherzogtum aufsteigende Baden. 1821 vereinte die unierte badische Landeskirche Reformierte und Lutheraner. Der langjährige Pfarrgemeinderat Norbert Weis erinnert sich, dass nur wenige evangelische Familien in Wöschbach lebten, als er 1946 in den Ort kam. 1842 waren es gerade einmal neun Protestanten, nach dem Zweiten Weltkrieg erst rund 50. Am 25. September 1955 wurde ein Mehrzweckbau als evangelische Diaspora-Kapelle eingeweiht. Heute sind es 956 katholische und 597 evangelische Gemeindemitglieder.
In Graben waren es 1843 sechs Katholiken und Mitte 1945 kaum mehr als 100. 1946 kletterte ihre Zahl schlagartig durch Vertriebene auf 783. Nach einer ersten Notunterkunft vollzog sich die Einweihung des neuen Gotteshauses im Dezember 1951. Heute sind es rund 1.200 Katholiken in Graben und 3.200 in Neudorf. Die Zahl der Evangelischen war dort in den 1990er Jahren auf mittlerweile 1.000 gewachsen. Sie erhielten 1998 ein kleineres Zentrum in der Hebelstraße. Ende 2021 zählte Graben-Neudorf 3.510 Evangelische. Unterm Strich haben sich in der Region die Zahlen deutlich angenähert, wobei die Ursprünge nach wie vor zu Tage treten.
In Walzbachtal kommt das ehemals speyerische Jöhlingen heute auf 2.140 Katholiken bei rund 1.400 Evangelischen. In Wössingen sind es 808 Katholiken und 1.700 Evangelische. Eine historische Ausnahme macht Weingarten, das bis 1803 kurpfälzisch war. 1843 sind dort 2.075 (heute 3.306) Evangelische und 876 (heute 2.881) Katholische erfasst. 1871 lagen die Zahlen bei 1.901 und 1.120. Insofern gab es in diesen Zeiten dort nicht die krassen Unterschiede wie andernorts. Gemäß Zensus waren 2011 bei zunehmender Annäherung knapp 40 Prozent der Weingartener evangelisch und knapp über 32 Prozent katholisch. 1842 besaß die Gemeinde zudem eine im Vergleich ungewöhnliche hohe Zahl von 149 jüdischen Einwohnern.
Ihre Spuren indessen hinterlassen überall die Kirchenaustritte. In Wöschbach spricht Norbert Weis auch die Zuzüge Konfessionsloser ein. Bei einer Bevölkerung von 1946 rund 1.200 und heute knapp 3. 000 Einwohnern schätzt er ihren Anteil höher als den der Evangelischen ein.
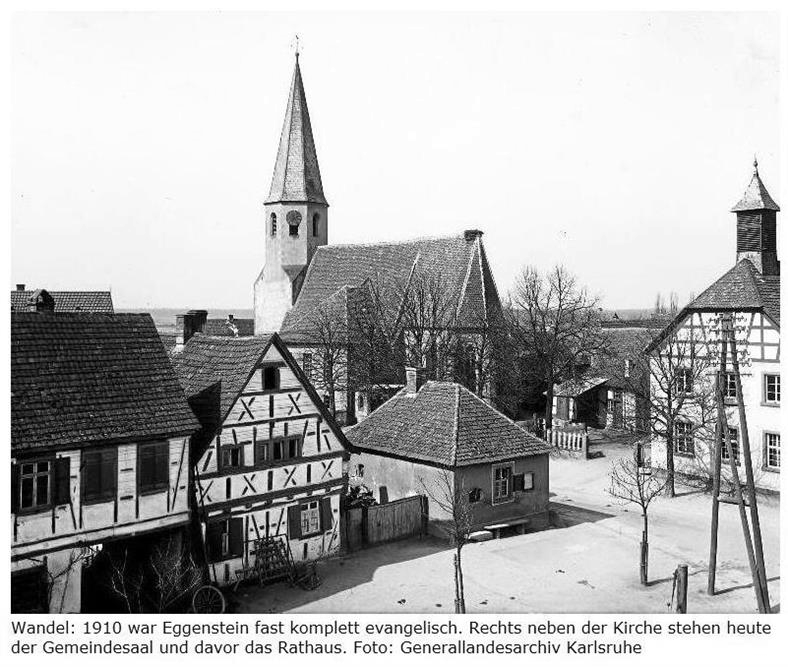 |
 |