Gemeinden müssen auf Gebäude verzichten
Die evangelische Kirche in Baden muss sparen. Im Herbst fällt die Entscheidung, welche Kirchen und Gemeindehäuser im Kirchenbezirk Markgräflerland künftig keine Bauzuschüsse der Landeskirche mehr erhalten.
Kreis Lörrach Im Kirchenbezirk, der bis auf Schliengen deckungsgleich ist mit dem Landkreis Lörrach, gibt es 114 Kirchen, Gemeindehäuser und -zentren. 27 davon sind beim Strategieprozess Ekiba 2032 (siehe Box) außen vor. Sie stehen nur zu einem geringen Teil (weniger als 31 Prozent) in der Baupflicht der Kirche, zum überwiegenden Teil in der Pflicht Dritter. Das gilt etwa für die Stadtkirche und die Alte Kirche in Schopfheim sowie für etliche Dorfkirchen im Rebland.
Für die verbleibenden 87 Gebäude verabschiedet der Bezirkskirchenrat als Leitungsgremium im Herbst einen Plan, indem er eine sogenannte Beampelung vornimmt: Er legt fest, welche Gebäude rot, gelb oder grün sein sollen. Bei grünen Gebäuden finanziert die Landeskirche auch künftig Bauvorhaben mit, aber nicht automatisch, sondern weiterhin nach Genehmigungsverfahren und Priorisierung. Bei roten Gebäuden entfällt diese Unterstützung; die Finanzierung von Baumaßnahmen müssen die Gemeinden anderweitig stemmen, wenn sie das Gebäude halten und nicht aufgegeben und verkaufen wollen. Bei gelben Gebäuden ist eine Entscheidung aufgeschoben. Der Entscheidungsprozess über die Pfarrhäuser steht im Jahr 2025 an, kann aber da und dort vorgezogen werden. Kindergärten sind nach jetziger Planung außen vor.
Nach den Vorgaben der Landeskirche dürfen im Kirchenbezirk maximal 25 der 87 Gebäude grün sein; mindestens 34 müssen rot sein; der Rest bleibt gelb. Eine wichtige Rolle bei der Einstufung spielt der Wiederherstellungswert. Diese statische Größe, die den Aufwand für den Erhalt von Gebäuden vergleichbar macht, liegt im Kirchenbezirk im Schnitt bei zwei Millionen Euro, erläutert Pressesprecher Christoph Zacheus-Hufeisen. Bei maximal 25 grünen Gebäuden ergibt sich so auf Bezirksebene eine Deckelung von rund 50 Millionen Euro.
Eine Arbeitsgruppe des Bezirkskirchenrates hat einen ersten Vorschlag für die Beampelung erarbeitet, der in den vergangenen Wochen den Gemeinden und Kooperationsräumen – den sechs regionalen Einheiten zwischen Bezirk und Gemeinde – vorgelegt und dort diskutiert wurde. „Er sollte anregen, eigene Vorschläge und Gedanken zu entwickeln“, erklärt Zacheus-Hufeisen. Inzwischen liegen die Rückmeldungen vor; der Bezirkskirchenrat befasste sich damit am vorvergangenen Wochenende intensiv.
Die Gemeinden und Kooperationsräume hätten sich um eine sachliche und angemessene Reaktion bemüht, kommentiert Dekanin Bärbel Schäfer. Hinter den Kulissen möge sich da und dort Ärger und Enttäuschung Luft gemacht haben. „Die Rückmeldungen sind aber sehr fair und durchdacht.“ Beispielsweise überlegten Gemeinden gemeinsam, wie über einen Tausch ein Gebäude auf grün gestuft werden könnte, zulasten eines anderen, das dann rot wird. Es wurde, so Schäfers Eindruck, verstanden, dass es um einen gravierenden Gebäudeabbau geht. Allen Ideen und konstruktiven Überlegungen könne man aber nicht folgen. Die Gegenvorschläge summierten sich nämlich auf 75 Millionen Euro, lagen also deutlich über der Deckelung.
In einem nächsten Schritt erarbeitet der Bezirkskirchenrat nun einen konkreten Beschlussvorschlag. Dieser geht erneut an die Gemeinden, damit diese bis etwa Anfang Juli darüber beraten und ein Feedback geben können. Anpassungen würden in der zweiten Runde aber nur vorgenommen, wenn sehr schwerwiegende Argumente vorgebracht werden, dämpft Schäfer allzu hohe Erwartungen.
Leitend bei allen Überlegungen und bei der Entscheidung des Bezirkskirchenrates über die Ampelfarbe der Gebäude ist die Frage „Welche Räume brauchen wir und die nachfolgenden Generationen, um den Menschen das Evangelium nahe zu bringen, Kirche zu erleben und zu gestalten?“ Es gelte also, auch an Kinder und Kindeskinder zu denken und zu berücksichtigen, dass sich Bedürfnisse verändern, erläutert die Dekanin. Auch der Klimaschutz spielt bei der Beurteilung eine Rolle: Bei Gemeindehäusern, die energetisch nicht mehr tragbar sind, sei eine Trennung naheliegend. Kirchen hingegen, sagt Bärbel Schäfer, hätten bei den meisten Mitgliedern eine andere, emotionale Konnotation.
Was mit einer roten Kirche geschehen kann, darauf habe sie keine umfängliche Antwort, räumt die Dekanin ein. Denn auch eine Umnutzung als Museum, wie die Barfüsserkirche in Basel, als Kneipe oder öffentlicher Raum will finanziert sein. Zacheus-Hufeisen spricht von einer großen Herausforderung, die im Einzelfall zu betrachten sei. Er versichert aber, dass Landeskirche und Bezirk auch nach der Entscheidung im Herbst den Gemeinden beratend zur Seite stehen werde, um Lösungen zu finden. Überlegenswert sind laut Schäfer etwa Kooperationen mit katholischen oder politischen Gemeinden. Dass der Prozess schmerzhaft ist, dessen ist sich die Dekanin bewusst. Ein hierarchischer autoritärer Eingriff sei er nicht. „Wir ringen um Entscheidungen, müssen uns aber den Realitäten stellen, ergänzt Zacheus-Hufeisen.
Und noch etwas gibt Bärbel Schäfer zu bedenken: Bei all den Zahlen und technischen Aspekten in dem Entscheidungsprozess dürfe man nicht vergessen, dass es letztlich um die Kirche und um die Zukunft der Kirche gehe. Diese bestehe auch aus Gebäuden, zum allergrößten Teil aber aus Menschen, die eine geistliche Heimat finden sollen und einen Raum, um ihre Sehnsüchte und Fragen, Sorgen und Freuden miteinander zu teilen, getragen vom Glauben an den dreieinen Gott als Quelle des Lebens. Die schwierigen Schritte der Veränderungen böten die Chance, neue geistliche Räume miteinander zu entdecken und zu gestalten, ist sie überzeugt. Die Reduktion bei den Gebäuden ermögliche, auch künftig zu gewährleisten, bei den Menschen zu sein mit Angeboten, die diese brauchen, merkt Zacheus-Hufeisen an: „Kirche hat sich immer verändert und wird sich verändern.“ Was bleibt, ist ihre Botschaft.
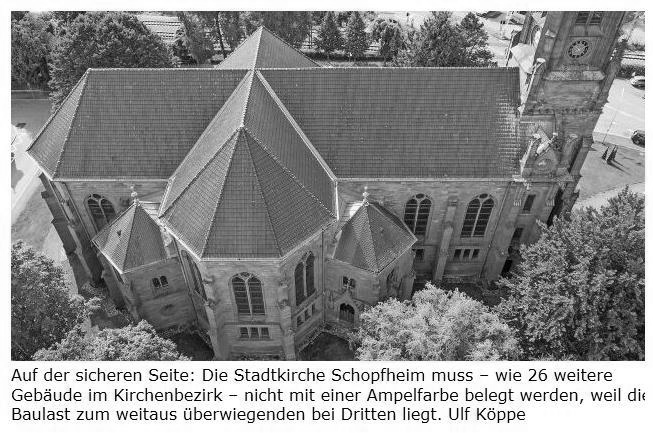 |
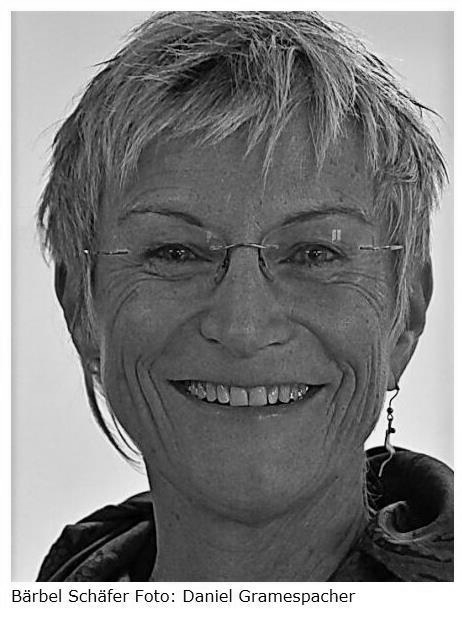 |
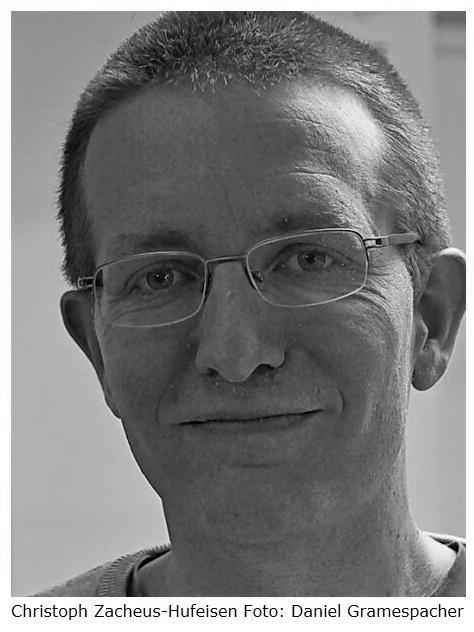 |