Legenden um Frauen am Kreuz
„Frau am Kreuz“ heißt eine Ausstellung, die am Sonntag in der evangelischen Stadtkirche in Schopfheim eröffnet wurde. Die Darstellungen haben viele Besucher verblüfft.
SCHOPFHEIM Auch wenn die meisten Ausstellungsbesucher und -besucherinnen bisher noch wenig oder nichts von der gekreuzigten Frau gehört hatten, reichen diesbezügliche Darstellungen bis in die Antike zurück, sagte Beate Schmidtgen, Pfarrerin und Leiterin der Erwachsenenbildung Markgräflerland, in der Einführung. Neben dem Altar in der Stadtkirche zieht das Bild einer gekreuzigten Frau interessierte Blicke auf sich. Die Gekreuzigte trägt ein rotes Kleid, das an den Füßen zugebunden ist. Sie hat lange Haare, auf dem Kopf eine Krone, umgeben von einem Heiligenschein. Es ist eine Darstellung der heiligen Kümmernis oder Wilgefortis, die für ihren Glauben gestorben ist. Andere Bilder zeigen die heilige Kümmernis mit einem Bart.
Um die Frau am Kreuz rankt sich eine Heiligenlegende, die im 2. Jahrhundert spielt und von den Gebrüdern Grimm aufgenommen wurde. Demnach war Wilgefortis eine schöne Königstochter aus Lusitanien, dem heutigen Portugal. Ihr Vater wollte sie mit einem heidnischen Prinzen vermählen, was sie verweigerte. Sie bat Gott, sie körperlich zu entstellen, damit die Männer sie nicht weiter begehrten. Der Tochter wuchs daraufhin ein Bart. Der erzürnte Vater ließ sie kreuzigen.
Die „Frau am Kreuz“ gewann im Mittelalter eine zentrale Bedeutung, sagte Pfarrerin Ursula Schmitthenner in ihrer Gottesdienstpredigt. Die Beginen, so hieß die Frauenbewegung, die ihren Anfang in den Niederlanden nahm, hatten gemeinsame Häuser und Höfe. Vom 16. Jahrhundert an war die Frauenbewegung in ganz Europa zu finden. Die Frauen lebten aus den verschiedensten Gründen ohne Männer und gaben ein Keuschheitsgelübde auf Zeit ab. Sie stammten aus allen gesellschaftlichen Schichten, arbeiteten in Lazaretten, Suppenküchen oder waren gute Handwerkerinnen. Allerdings weckte ihre ökonomische Unabhängigkeit Neid. Die Frauen wurden auch den Kirchen zu mächtig, so dass sie als Laien-Schwestern nicht mehr anerkannt wurden. Papst Pius IV habe die Beginen verboten, so Schmitthenner, die Frauen wurden als Hexen verfolgt und verbrannt.
Es sei sehr schwer gewesen, Zeugnisse von gekreuzigten Frauen aus früher Zeit oder gar bis in die Antike zu finden, erzählte Beate Schmidtgen. Erst ab dem 14. Jahrhundert habe es eine Flut von Bildern gegeben, die bis ins 20. Jahrhundert hineinreichte. Der Name „heilige Kümmernis“ passe, meinte sie, denn Frauen kamen mit ihrem Kummer zu ihr, sei es wegen Krankheit, Kinderlosigkeit, Kinderschwemme oder wegen Gewalterfahrungen. Interessant ist für Beate Schmidtgen, dass sich auch Männer an die „heilige Kümmernis“ wandten, zum Beispiel, wenn sie zum Krieg gezwungen wurden oder ganz einfach frei sein wollten. In der Gegenwart habe die heilige Wilgefortis zum Beispiel für queere Menschen an Bedeutung gewonnen, da sie Mut mache, gegen den Strom zu schwimmen. Und die Frau am Kreuz habe es bis in die moderne Popkultur gebracht, wenn man an Conchita Wurst oder Madonna vorm Kreuz denke. Die Ausstellung ist von Montag bis Samstag, 10 bis 16 Uhr, Sonntag 11 bis 16 Uhr geöffnet. Am 15. März hält Petra Heilig online in der Stadtkirche Schopfheim (Übertragung) einen Vortrag zur „Frau am Kreuz“. Wer online teilnehmen will, sollte sich unter ww.eeb-sued-west.de anmelden.
 |
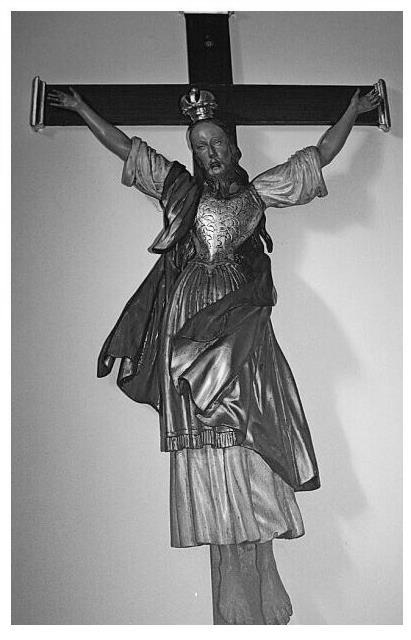 |